Fresenius hat über seine Operating Company Fresenius Kabi und den Lizenzpartner Formycon bekanntgegeben, dass die Europäische Kommission (EC) die Marktzulassung für FYB202 erteilt hat. FYB202 ist ein Biosimilar zu Stelara® (Ustekinumab) zur Behandlung verschiedener schwerer Entzündungskrankheiten.
Im Februar 2023 hatten Fresenius Kabi und Formycon eine globale Kommerzialisierungspartnerschaft für den Biosimilar-Kandidaten Ustekinumab vereinbart, welche die weltweit wichtigsten Märkte umfasst. Im März 2024 haben Formycon und Fresenius Kabi eine Vergleichsvereinbarung mit Johnson & Johnson über die Vermarktung ihres Ustekinumab-Biosimilars in Europa und Kanada getroffen. Die Bedingungen der Vereinbarung sind vertraulich.
Fresenius Kabi setzt damit weiter das Biopharma-Momentum fort und strebt den Ausbau dieses starken Geschäfts, als einem der wesentlichen Eckpfeiler von #FutureFresenius, an.
Stelara® ist eine eingetragene Marke von Johnson & Johnson
Mit Wirkung zum 1. Oktober übernimmt der international erfahrene Gesundheits- und Kapitalmarktexperte Nick Stone die Leitung der Investor-Relations-Funktion bei Fresenius. Der bisherige Leiter, Markus Georgi, wird nach 9 Jahren in der Funktion das Unternehmen verlassen, um sich neuen Aufgaben zu widmen.
Michael Sen, Vorstandsvorsitzender von Fresenius: „Ich freue mich sehr, dass wir mit Nick Stone einen anerkannten Investor-Relations-Manager für diese wichtige Rolle gewinnen konnten. Das Vertrauen von Investoren und Analysten in Fresenius international weiter zu stärken, ist von zentraler Bedeutung für den langfristigen Erfolg von #FutureFresenius. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Gesundheitsindustrie und seiner exzellenten Vernetzung in den internationalen Kapitalmärkten vereint Nick Stone entscheidende Kompetenzen für diese Aufgabe. Markus Georgi hat die Investor-Relations-Funktion bei Fresenius in den vergangenen Jahren maßgeblich weiterentwickelt. Ich danke ihm für seinen großen Einsatz und wünsche ihm alles erdenklich Gute für seinen weiteren Weg.“
Nick Stone wechselt zum 1. Oktober 2024 zu Fresenius und wird seinen Sitz in Bad Homburg haben. Stone kommt von GSK Plc (ehemals GlaxoSmithKline), einem internationalen Pharmaunternehmen mit Sitz in London, UK, wo er seit 2021 als Senior Vice President die globale Investor-Relations-Funktion leitete. Zuvor verantwortete er verschiedene Rollen in der Unternehmensstrategie, im Vertrieb, im Produkt- und Portfoliomanagement sowie Investor Relations bei AstraZeneca Plc. Nick Stone studierte Rechtswissenschaften und Kriminologie an der University of Lincoln und an der Staffordshire University in England.
Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren, die Verfügbarkeit finanzieller Mittel sowie unvorhergesehene Auswirkungen internationaler Konflikte. Fresenius übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.
Mit Wirkung zum 1. Oktober übernimmt der international erfahrene Gesundheits- und Kapitalmarktexperte Nick Stone die Leitung der Investor-Relations-Funktion bei Fresenius. Der bisherige Leiter, Markus Georgi, wird nach 9 Jahren in der Funktion das Unternehmen verlassen, um sich neuen Aufgaben zu widmen.
Michael Sen, Vorstandsvorsitzender von Fresenius: „Ich freue mich sehr, dass wir mit Nick Stone einen anerkannten Investor-Relations-Manager für diese wichtige Rolle gewinnen konnten. Das Vertrauen von Investoren und Analysten in Fresenius international weiter zu stärken, ist von zentraler Bedeutung für den langfristigen Erfolg von #FutureFresenius. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Gesundheitsindustrie und seiner exzellenten Vernetzung in den internationalen Kapitalmärkten vereint Nick Stone entscheidende Kompetenzen für diese Aufgabe. Markus Georgi hat die Investor-Relations-Funktion bei Fresenius in den vergangenen Jahren maßgeblich weiterentwickelt. Ich danke ihm für seinen großen Einsatz und wünsche ihm alles erdenklich Gute für seinen weiteren Weg.“
Nick Stone wechselt zum 1. Oktober 2024 zu Fresenius und wird seinen Sitz in Bad Homburg haben. Stone kommt von GSK Plc (ehemals GlaxoSmithKline), einem internationalen Pharmaunternehmen mit Sitz in London, UK, wo er seit 2021 als Senior Vice President die globale Investor-Relations-Funktion leitete. Zuvor verantwortete er verschiedene Rollen in der Unternehmensstrategie, im Vertrieb, im Produkt- und Portfoliomanagement sowie Investor Relations bei AstraZeneca Plc. Nick Stone studierte Rechtswissenschaften und Kriminologie an der University of Lincoln und an der Staffordshire University in England.
Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren, die Verfügbarkeit finanzieller Mittel sowie unvorhergesehene Auswirkungen internationaler Konflikte. Fresenius übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.
- Herzzentrum Leipzig Vorreiter in der minimalinvasiven Herzchirurgie, der interventionellen Kardiologie und der Elektrophysiologie
- Vertreter:innen aus Politik, Forschung und Klinik würdigen Erfolgsgeschichte des Herzzentrums
- Fresenius setzt mit Care-Provision-Plattform auf Cluster- und Spezialisierungsstrategie
Das international bekannte Herzzentrum Leipzig von Fresenius Helios feiert sein 30-jähriges Bestehen. Zum Jubiläums-Festakt würdigten Vertreter:innen aus Politik, Forschung und Klinik das Herzzentrum und seine Geschichte der Spitzenmedizin am Helios Standort Leipzig. Neben dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer gehörten auch Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung und die Rektorin der Universität Leipzig, Professorin Eva Inés Obergfell zu den Gästen.
Robert Möller, Fresenius-Vorstandsmitglied und Helios CEO:
„Committed to Life – dieses Versprechen von Fresenius ist Verantwortung zugleich. Wir retten Menschenleben und verbessern Lebensqualität und Gesundheit. Wir ermöglichen Zugang zu bezahlbarer, innovativer Medizin in höchster Qualität. All das zeigt sich eindrucksvoll hier am Herzzentrum. Ich freue mich sehr, dass wir in Leipzig und der Region als eine wichtige, medizinische Säule gelten und in den Bereichen der Kinderkardiologie, Herzchirurgie und Kardiologie universitär aufgestellt sind. Damit können wir sowohl im klinischen als auch im Forschungsbereich zukunftsorientierte Projekte vorantreiben. Dies ist eine Erfolgsgeschichte der vertrauensvollen Kooperation auf Augenhöhe mit der Universität Leipzig und dem Freistaat Sachsen. Das Herzzentrum Leipzig hat in seiner 30-jährigen Geschichte modernste Diagnose- und Therapieverfahren sowie vielschichtige Forschungsinitiativen über die nationalen Grenzen hinweg getragen und eine weltweite Strahlkraft entwickelt.“
Michael Kretschmer, Ministerpräsident des Freistaates Sachsen:
„Seit 30 Jahren steht das Herzzentrum Leipzig für Spitzenmedizin und medizinische Innovationen. Patienten jeden Alters wissen, dass sie bei Herzproblemen hier eine erstklassige Versorgung bekommen. Auch andere Krankenhäuser aus der Region können sich auf das Fachwissen der Expertinnen und Experten aus Leipzig verlassen. Das macht das Herzzentrum zu einem wichtigen Pfeiler der medizinischen Versorgung in unserer Heimat. Der Freistaat wird das Herzzentrum auch zukünftig unterstützen und investiert in die Erneuerung und Erweiterung der Kinderkardiologie sowie in Digitalisierung damit die Menschen weiterhin auf höchstem Niveau versorgt werden können.“
Spitzenmedizin, die Geschichte schreibt
In den vergangenen 30 Jahren hat das Herzzentrum Leipzig zahlreiche Meilensteine erreicht: Mit modernster Technologie haben Ärzt:innen und Pflegekräfte bisher über 100.000 Herz-Operationen, mehr als 270.000 Herzkatheter-Eingriffe und 100.000 Ablationen vorgenommen und so das Leben von rund 500.000 Patient:innen verbessert. Besonders hervorzuheben sind die Fortschritte in der minimalinvasiven Herzchirurgie, der interventionellen Kardiologie und der Elektrophysiologie, die das Herzzentrum Leipzig zu einem Vorreiter seiner Branche gemacht haben. Darüber hinaus zählen die Kardiologie und die Herzchirurgie des Herzzentrums zu den größten universitären Fachabteilungen Deutschlands. Die Universitätsklinik für Kinderkardiologie ist zudem das einzige Kinderherzzentrum in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Heute widmen sich an der Klinik über 1.450 Mitarbeitende aus 50 Nationen und verschiedener medizinischer Spezialgebiete der Herzgesundheit.
Helios deutschlandweit stark in der Herzmedizin
Helios steht als Kernbestandteil der Fresenius Care-Provision-Plattform für Exzellenz und hohe medizinische Ergebnisqualität entlang der gesamten Patientenreise. In Deutschland betreibt Fresenius Helios sechs Herzzentren: in Karlsruhe, Krefeld, Leipzig, Siegburg, Schwerin und Wuppertal. In den Herzzentren arbeiten die Beschäftigten teils überregional in hochspezialisierten Teams eng zusammen. Sie sind damit Ausdruck der Cluster- und Spezialisierungsstrategie von Fresenius Helios.
Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren, die Verfügbarkeit finanzieller Mittel sowie unvorhergesehene Auswirkungen internationaler Konflikte. Fresenius übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

CAR-T-Zelltherapie ist eine der innovativsten Gen- und Zelltherapien. Im Interview mit Fresenius Redakteurin Brigitte Baas spricht Chris Wegener Director, CGT R&D, Research and Advanced Technologies, Transfusion and Cell Therapies bei Fresenius Kabi USA, über die Anfänge der Geräteentwicklung für die CAR-T-Zelltherapie und wie er die Zukunft der Zellverarbeitung in den nächsten fünf bis zehn Jahren sieht.
(Veröffentlicht: November 2024)
Chris, man kann sagen, dass Sie und Ihr Team bei Fresenius Kabi USA im Zentrum der Produktentwicklung stehen, wenn es um Geräte für die Car-T-Zell-Therapie geht. Wie hat die Forschungsarbeit zu dieser neuen Therapiemethode begonnen?
Chris Wegener: Die ersten klinischen Studien am Menschen wurden von Forschern im Jahr 2011 durchgeführt. Das war sozusagen der Höhepunkt vieler präklinischer Arbeiten, die bereits in den 1990er Jahren begonnen hatten. Die ersten kommerziellen CAR-T-Zulassungen erfolgten dann im Jahr 2017.
Wie kam es überhaupt dazu, dass sich Fresenius Kabi vor einiger Zeit auf dem relativ neuen Gebiet der Gen- und Zelltherapie engagiert hat? Das war ja lange Zeit nicht der Kern unseres Portfolios, oder?
Chris Wegener: Wir müssen hier ein wenig zurückgehen. Und ich gebe zu: Wir sind eher zufällig auf das Feld der Zell- und Gentherapie gekommen. Fresenius Kabi hatte jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und Automatisierung von Einweg-Schlauchsystemen, sei es für die Blutentnahme, die Blutseparation – Apherese genannt – oder für die Transfusionsmedizin. Als sich herausstellte, dass es im Bereich der CGT an den richtigen Werkzeugen fehlte, überlegten wir, ob es nicht möglich wäre, unsere Komponenten zur Unterstützung dieses wachsenden Bedarfs einzusetzen. Denn die automatisierten Werkzeuge, die wir zu diesem Zeitpunkt entwickelten, waren in der Lage, bestimmte Teile der therapeutischen Arbeitsabläufe in der CAR-T-Zelltherapie durchzuführen: Sie sind zudem mit Einweg-Schlauchsystemen ausgestattet und funktionieren ähnlich wie ein Apherese- oder Dialysegerät.

Und wie ging es dann weiter?
Chris Wegener: Wir haben dann schnell damit begonnen, unsere Pumpen-, Schlauch- und Ventiltechnologien so umzurüsten, dass ein flexibler Einsatz möglich wird. Zum Teil deshalb, weil wir als Neulinge in der Welt der CGT-Herstellung nicht wussten, wie die Endanwender das System nutzen würden. Wir wussten ja nicht, dass diese Flexibilität einer der Hauptgründe dafür sein würde, dass die Menschen unsere Plattformen annehmen würden! Doch genau mit diesem Know-how konnten wir die Zellverarbeitungssysteme Lovo und Cue entwickeln: Wir haben einfach unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Transfusionsmedizin und Apherese auf die Zell- und Gentherapie übertragen.
Die Herstellung von Immunzellen ist sehr komplex, und die Produktionszeit dauert oft sehr lange. Warum genau ist das so?
Chris Wegener: Bei den meisten CAR-T-Verfahren dauert die eigentliche Produktion der Zellen nur etwa sieben bis neun Tage. Da es sich jedoch um personalisierte Medikamente handelt, muss jede Patientencharge einer umfangreichen Qualitätskontrolle unterzogen werden. Diese Qualitätstests dauern oft länger als die Produktion selbst.
Und wenn die Qualitätskontrolle abgeschlossen ist, muss der Patient auch auf die Infusion vorbereitet werden, was eine kurze Chemotherapie beinhalten kann. Erst dann, wenn sowohl der Patient als auch die Zellen bereit sind und sich am selben Ort befinden, können die Zellen reinfundiert werden. Aus diesem Grund müssen die meisten CAR-T-Zellen am Ende ihres Produktionsprozesses eingefroren werden: Denn die Funktion der Zellen muss erhalten bleiben, bis alles für die Infusion bereitsteht.
Was genau sind die Aufgaben von Lovo und Cue im komplexen CAR-T-Zellproduktionsprozess, bis die fertigen Zellkulturen für die Therapie schließlich aus dem Bioreaktor entnommen werden? Also in welchem Teil des Produktionsprozesses werden Lovo und Cue eingesetzt?
Chris Wegener: Im Kern verwenden Lovo und Cue eine spezielle Art von Filter, besser bekannt als Spinnmembranfilter. Sie tragen dazu bei, Zellen effizient zu waschen und zu konzentrieren. Das Waschen und Konzentrieren ist ein notwendiger Schritt an vielen Stellen des Produktionsablaufs einer Zelltherapie. Er kann dazu dienen, Blutverunreinigungen aus dem Ausgangsmaterial des Patienten zu entfernen, z. B. Thrombozyten oder Plasma. Oder, wenn Zellen aus einem Bioreaktor entnommen werden, muss die Flüssigkeit, in der die Zellen suspendiert sind, von einem nährstoffreichen Wachstumsmedium in ein für die Kryokonservierung geeignetes Medium umgewandelt werden.
Die Verarbeitungssysteme Lovo und Cue haben sich für all diese Prozesse als sehr effektiv erwiesen. Beide Systeme schneiden gut ab, weil sie speziell für eine einfache und zellschonende Bedienung konzipiert wurden. Dabei hilft es, dass Fresenius Kabi als eines der ersten Unternehmen mit einem CGT-spezifischen System auf dem Markt war. Davor mussten die Entwickler auf „geliehene" Technologie zurückgreifen, die weder für den Einsatz geeignet noch einfach zu bedienen war.
Das Lovo-System zum Beispiel gewährleistet eine vollautomatische und schnelle Verarbeitung des Labormaterials. Wir können jeden Aspekt des Prozesses kontrollieren – über den gesamten Produktionszeitraum. Darüber hinaus ist es so flexibel konfigurierbar, dass Praktiker Lovo für eine Vielzahl von Zelltherapieprozessen einsetzen können. Darüber hinaus kann Lovo große Volumina schnell verarbeiten.

Und wie lassen sich die besonderen Eigenschaften des Cue-Verarbeitungssystems auf den Punkt bringen?
Chris Wegener: Das Cue-System wurde, wie Sie sich vielleicht erinnern, später entwickelt. Es sollte einige der Lücken schließen, die Lovo aufwies. Beide Systeme nutzen dieselbe Spinnmembran-Filtrationstechnologie, aber Cue verwendet ein proprietäres pneumatisches Spritzenpumpensystem, das eine viel feinere Kontrolle über kleine Flüssigkeitsvolumina ermöglicht. Das Cue-Verarbeitungssystem eignet sich damit besonders für Anwendungen, bei denen die Volumenkontrolle wichtig ist, wie etwa bei der Formulierung.
Wir haben erfahren, dass weder Lovo noch Cue den gesamten Produktionsprozess allein bewältigen können. Erläutern Sie bitte, welche anderen Prozesse oder Systeme davor und danach eingebunden werden müssen.
Chris Wegener: Es gibt drei weitere primäre Systeme, die ebenfalls erforderlich sind, um CAR-T-Zellen zu erzeugen. Das erste ist die Zellselektion. Der Körper verfügt über viele verschiedene Arten von Immunzellen oder weißen Blutkörperchen, darunter B-Zellen, Monozyten, Makrophagen und T-Zellen. Ohne T-Zellen kann man keine CAR-T-Zellen herstellen. Die T-Zellen werden dazu an ein speziell beschichtetes, oft magnetisches Kügelchen gebunden und es wird eine magnetische Kraft ausgeübt, um die T-Zellen physisch von den Nicht-Zielzellen wegzuziehen.
Der zweite Schritt ist die Genmodifikation. Bei den CAR-Ts der ersten Generation werden künstlich hergestellte Viren verwendet, um die T-Zellen zu infizieren, damit sie neue Ziele, wie Krebszellen, erkennen können. In diesem Fall werden Viren nur verwendet, um das genetische Material in die Zellen zu bringen, aber es gibt einige sehr interessante Alternativen in der Entwicklung, wie z. B. die Verwendung von mechanischem „Quetschen", elektrischen Feldern oder Lipid-Nanopartikeln, um genetische Ladungen zu liefern. Schließlich müssen die Zellen auf eine ausreichende Zelldosis expandiert oder gezüchtet werden, wofür eine Reihe verschiedener kleiner Bioreaktoren verwendet werden können.
Zwischen all diesen spezialisierten Schritten müssen die Zellen für den jeweils nächsten vorbereitet werden, und genau hier zeigt sich die Flexibilität von Lovo und Cue, die alle möglichen Anwendungen erlauben. Dieser ganze Produktionsprozess ist das, was man als „modulare Verarbeitung" bezeichnet: Mehrere unterschiedliche Prozesse können je nach Bedarf integriert werden.
Wenn Sie einen Blick auf die nächsten fünf oder zehn Jahre werfen, wie sieht Ihrer Meinung nach die Zukunft der Zellverarbeitung für die Gen- und Zelltherapie aus?
Chris Wegener: Die Wirksamkeit der neuen Generation von Medikamenten – der CAR-T-Zelltherapien – ist zwar hervorragend, aber die Herausforderungen bei der Herstellung und die Kosten haben die Zahl der behandelten Patienten begrenzt. Experten schätzen, dass nur 20 bis 25 Prozent der in Frage kommenden Patienten eine Behandlung erhalten. Ich denke, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren der zentralisierte Herstellungsansatz für viele Arten von Zelltherapien durch ein anderes System ergänzt wird: Eines, das weiter vereinfacht wurde und am Point-of-Care, also am Krankenbett des Patienten, eingesetzt werden kann. Die Patienten sollten eine lokale Versorgung erwarten dürfen: Eine, bei der ihre Behandlungen in den Gesundheitseinrichtungen in der Nähe zu einem erschwinglichen Preis verschrieben, hergestellt und verabreicht werden.
Kontakt
Fresenius Kabi AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg v.d.H
Germany
T +49 (0) 6172 686 0
communication@fresenius-kabi.com
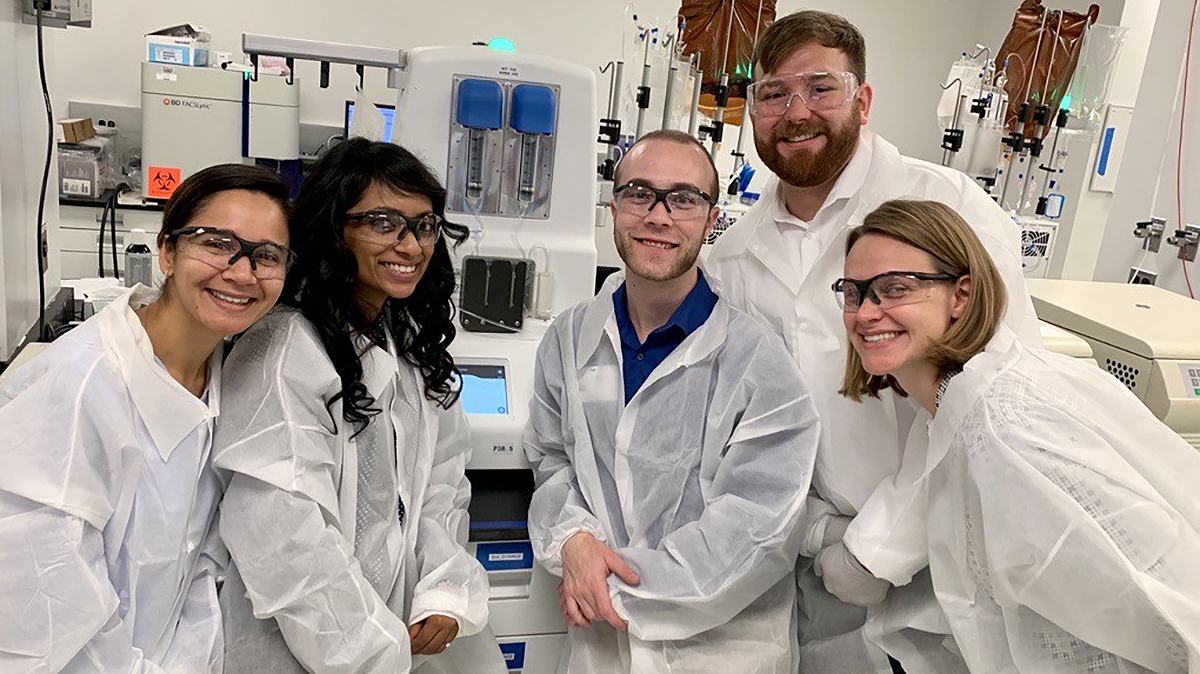
Die so genannten CAR-T-Zelltherapien gehören zu den innovativsten Therapiemöglichkeiten, die der Medizin heute zur Verfügung stehen, etwa bei bösartigen Blutkrebserkrankungen. Um sie anzuwenden, benötigen Mediziner die lebenden Zellen des Patienten, die dann in einem aufwendigen Verfahren speziell aufbereitet werden. Der gesamte Herstellungsprozess für diese zellbasierten Therapeutika ist äußerst komplex und logistisch anspruchsvoll, was die therapeutischen Anwendungen teuer macht und ihre Zugänglichkeit einschränkt.
(Veröffentlicht: November 2024)
Zunächst werden dem Patienten die Blutzellen entnommen. Die Immunzellen werden dann isoliert und genetisch verändert, in der Regel mit einem gentechnisch veränderten Virus. Anschließend werden sie vermehrt – das heißt zu einer großen Anzahl herangezüchtet – und aufbereitet, bevor sie dem Patienten wieder zugeführt werden. All diese Schritte müssen in einer sterilen Umgebung für eine Chargengröße von genau einem Zähler durchgeführt werden. Denn jede CAR-T-Zelltherapie wird individuell auf den einzelnen Patienten zugeschnitten – und genau das macht die Therapie so besonders. Derzeit benötigen Mediziner und Forscher oft eine Produktionszeit von drei bis sechs Wochen, bis eine individuelle CAR-T-Therapie zur Verfügung steht.
Lesen Sie mehr dazu im Interview mit Chris Wegener, Director, CGT R&D, Research and Advanced Technologies, Transfusion and Cell Therapies Fresenius Kabi USA.
Erster Schritt zur Rationalisierung: Zellkulturen werden zentral in einer Produktionsstätte hergestellt
Wegen dieses langwierigen und komplexen Produktionsprozesses werden die Zellkulturen in der Regel zentral in einer einzigen Produktionsstätte hergestellt. Hier sind nicht zuletzt hochqualifiziertes Personal, eine spezielle Laborausstattung und die notwendige Infrastruktur vorhanden. All dies ist jedoch mit großen logistischen Herausforderungen verbunden und es kann zu Engpässen in der Produktion kommen. „Die Kosten sind in jedem Fall hoch“, erklärt Chris Wegener. „Die daraus resultierenden Therapien sind daher insgesamt sehr teuer und können derzeit nicht die Bedürfnisse der gesamten Patientenpopulation befriedigen“, fügt er hinzu.
Um die Behandlung zu demokratisieren und mehr Patienten zugänglich zu machen, arbeiten die Experten der Zell- und Gentherapieindustrie seit langem intensiv an neuen Ansätzen. Ihr Ziel ist es, den Prozess zu vereinfachen und damit die Produktionskosten der CAR-T-Zelltherapie zu senken. Dazu muss jedoch die Art und Weise, wie CAR-T-Zellen hergestellt werden, grundlegend geändert werden. Eine der Möglichkeiten zur Verschlankung des Prozesses besteht darin, die zentrale Produktion weiter zu automatisieren. Damit eine solche Automatisierung effizienter wird, müssen aber auch neue Werkzeuge entwickelt und zur Verfügung gestellt werden. Und genau an diesem Punkt der Entwicklungsgeschichte haben sich vor einiger Zeit die Ingenieurteams bei Fresenius an die Arbeit gemacht.

Forschungsteam von Fresenius Kabi tüftelt schon länger an den Zellverarbeitungssystemen Lovo und Cue
Fresenius Kabi unterstützt schon seit langem die Anwendung von CAR-T-Zelltherapien: Das Unternehmen ist zwar nicht direkt an der medizinischen Forschung beteiligt, stellt aber die dafür notwendige technische Laborausrüstung her.
In den USA entwickelt und produziert Fresenius Kabi zum Beispiel zwei neue Geräte, die für den CAR-T-Zelltherapieprozess unerlässlich sind. Seit 2016 arbeitet ein Entwicklungsteam unter der Ägide von Chris Wegener am Standort Lake Zurich an der Entwicklung des automatisierten Lovo Cell Processing Systems, einem Zellverarbeitungssystem. Und seit 2022 wird das Cue Cell Processing Systems weiterentwickelt. Die beiden Geräte werden im komplexen Herstellungsprozess der CAR-T-Zelltherapie als eine Art „Produktionsanlage“ eingesetzt.
„Wir haben sowohl für das Lovo als auch für das Cue-Entwicklungsprojekt ein zentrales F&E-Team, d.h. die Kolleginnen und Kollegen arbeiten je nach Bedarf an den Projekten mit – manchmal auch an mehreren gleichzeitig“, erklärt Wegener. „In der Spitze arbeiteten sowohl im Lovo als auch im Cue-Projektteam rund 35 Kollegen.“
Wie damals alles begonnen hat
Bereits im Jahr 2011, also vor fast 15 Jahren, hatte die Forschungscommunity weltweit mit der Entwicklung von CAR-T-Verfahren begonnen. „Die ersten Verfahren zur Herstellung der spezifischen Zellkulturen in einem Bioreaktor ähnelte der Arbeit in einem medizinischen Forschungslabor: Die Wissenschaftler bewegten sich in speziellen Reinräumen, trugen die bekannten ‚Hasenanzüge‘ und transferierten mit Pipetten Flüssigkeiten zwischen Reagenzgläsern und Kolben“, erinnert sich Wegener, der ursprünglich Biomedizintechnik studiert hat. „Aber als sich nach einiger Zeit herausstellte, dass die CAR-T-Zellen erstaunlich gut für die Zelltherapie geeignet waren, behielten die Forscher diesen mühsamen und zeitaufwändigen Ansatz bei.“
Um mehr Patienten behandeln zu können, müsste der Produktionsprozess jedoch in größere Reinräume verlegt und in einem größeren Maßstab durchgeführt werden. Diese Erweiterung wird im Fachjargon als Scale-out bezeichnet. „Aber irgendwann gehen einem die qualifizierten Forscher aus, dann hat man ein Ressourcenproblem – und es wird zu teuer, weitere Reinräume zu bauen“, sagt Wegener. „Dann ist es im Entwicklungsprozess einfach nicht mehr möglich, alle Patienten zu behandeln, die eine Therapie brauchen.“

Was für die Erweiterung des Herstellungsprozesses benötigt wird: hochkomplexe und voll automatisierte Geräte
Für die Erweiterung des Herstellungsprozesses sind laut Wegener vor allem zwei Dinge wichtig: „Es werden hochkomplexe und automatisierte Geräte benötigt, die speziell für die Produktionsprozesse der CAR-T-Zelltherapie entwickelt wurden. Und diese Systeme müssen in sich geschlossen, also steril sein“, so Wegener weiter. Es zeigte sich, dass die Systeme Lovo und Cue, die Kabi seit mehr als acht Jahren entwickelt, genau diese Anforderungen erfüllen: Sie sind so weit automatisiert, dass auch weniger qualifiziertes Personal mehrere Prozesse gleichzeitig durchführen kann. Außerdem sind sie flexibel und können so konfiguriert werden, dass sie viele verschiedene Arbeitsabläufe unterstützen. Und: Die Geräte können auch außerhalb des Reinraums betrieben werden.
„Damit sind wir der dringend benötigten Erweiterung des Fertigungsprozesses einen großen Schritt nähergekommen“, zieht Wegener ein positives Fazit. „Allerdings können die beiden Systeme Lovo und Cue den gesamten Prozess nicht allein bewältigen. Hier müssen weitere Instrumente und Verfahren vor- und nachgeschaltet werden“, erklärt der Experte.

Weiterer Entwicklungsschritt: Produktion wird weitgehend automatisiert, findet aber immer noch zentral in einer Produktionsstätte statt
Auch wenn die einzelnen Arbeitsschritte vollautomatisiert sind, erfolgt die Herstellung von Zellkulturen in der Regel immer noch zentral in einer einzigen Prozessanlage. Denn trotz aller Komplexität können solche Anlagen sehr zuverlässig hochwertige therapeutische Zellen produzieren. Allerdings befindet sich eine solche zentrale Anlage in der Regel nicht in der Nähe des Patienten.
Neueste Erkenntnisse im Rahmen der Gen- und Zelltherapie haben gezeigt, dass die immer noch weit verbreitete Praxis, hochautomatisierte Produktionsprozesse in einer zentralen Anlage – weit weg vom Patienten – ablaufen zu lassen, nicht immer sinnvoll ist. Deshalb arbeiten Forschung und Therapieentwickler intensiv daran, neue Wege zu finden, um den Produktionsprozess weiter zu vereinfachen. Wirksame und innovative Lösungen könnten in eine völlig neue Richtung weisen und die Dezentralisierung aller Prozesse bei der Herstellung von Zellkulturen beinhalten. Dies würde die Produktion näher an den so genannten „Point of Care" bringen – also ans Krankenbett bzw. an den Patienten.
„Und genau hier liegt der Schwerpunkt unserer Forschung: an Lösungen und Geräten der nächsten Technologiegeneration“, so Dr. Marc-Alexander Mahl, Leiter des Bereichs Pharma, Nutrition und Sustainability bei Fresenius Kabi. Darüber hinaus wird daran geforscht, den Produktionsprozess deutlich zu verkürzen – auf weniger als einen Tag oder sogar nur wenige Stunden.
Therapien der nächsten Generation: ermöglichen Behandlung direkt am Patientenbett
„Wir haben das Potenzial erkannt, das in den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen liegt“, erklärt Mahl. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Forschern und Entwicklern an speziellen Therapien der nächsten Generation von Produktionstechnologien zu arbeiten. Diese haben mittelfristig das Potenzial, die Prozesse direkt am Patientenbett durchzuführen.“
Wir rechnen jedoch mit besonderen Anwendungen oder Bedingungen, bei denen der therapeutische Produktionsprozess am Point of Care nicht optimal ist. „Es wird daher wichtig bleiben, parallel auch Laborprozesse für unsere Zellverarbeitungssysteme Lovo und Cue zu entwickeln und die bestehende Produktpalette weiter auszubauen“, ergänzt Dr. Mahl.
Erfahren Sie mehr über die Chancen und Risiken der CAR-T-Zelltherapie in unserem Interview mit Prof. Bertram Glaß, Chefarzt für Hämatologie und Zelltherapie im Helios Klinikum Berlin-Buch: CAR-T-Zelltherapie: innovative Therapie mithilfe genveränderter Zellen
Kontakt
Fresenius Kabi AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg v.d.H
T +49 (0) 6172 686 0
communication@fresenius-kabi.com
Die Veränderungsrate, wesentlicher Parameter für die Steigerung der Kostenerstattung von Krankenhausleistungen für das Jahr 2025, ist auf 4,41 % festgesetzt worden. Als weiterer Parameter fließt die Veränderung der Krankenhauskosten in die jährliche Ermittlung der Kostenerstattung ein. Die finale Steigerungsrate für die Kostenerstattung von Krankenhausleistungen im Jahr 2025, der sogenannte Veränderungswert, sollte spätestens bis Ende des Jahres feststehen.










